COP30: Ölreiche Länder und Industrienationen auf eigenen Vorteil bedacht
24.11.2025 | von Swissaid
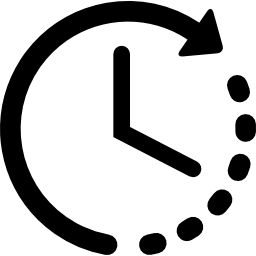 Lesezeit: 4 Minuten
Lesezeit: 4 Minuten
24.11.2025, An der UN-Klimakonferenz COP30 ist die Roadmap zum Ausstieg aus den fossilen Treibstoffen gescheitert. Dass dazu ein separater Prozess von Brasilien außerhalb der Verhandlungen angestoßen wird, ist ein schlechtes Zeichen für die internationale Einheit im Kampf gegen den Klimawandel - auch für den Globalen Süden. Dort leiden die Menschen am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels, obwohl sie ihn am wenigsten verursachen. Die Schweiz muss ihrerseits das Tempo erhöhen und im Inland mehr Treibhausgasemissionen reduzieren.
Fahrplan für den Ausstieg aus der fossilen Energie durchzubringen. In der Abschlusserklärung wurden weder Minimalbedingungen noch ein Zeitplan für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern festgelegt. Dies obwohl über 80 Staaten so eine Roadmap während der Konferenz vehement unterstützt hatten, darunter auch die Schweiz. Der Widerstand der ölreichen Länder war zu groß, so dass dieses zentrale Thema nun außerhalb der formellen Konferenz vorangetrieben wird.
«Es ist wichtig, dass die Schweiz unter den Unterstützern der Roadmap zum Ausstieg aus fossilen Energien war, denn ohne Verzicht auf fossile Energie lässt sich das gemeinsame Ziel, dass 1,5 Grad globale Erwärmung mittelfristig nicht überschritten werden, nicht einhalten. Nun müssen den Worten auch Taten folgen. Die Schweiz muss ehrgeizigere Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Inland, und für die erneuerbaren Energien durchsetzen, und entsprechend unserer Verantwortung und Wirtschaftskraft zur Klimafinanzierung beitragen», sagt Sonja Tschirren, Klima Expertin bei SWISSAID.
Drei Mal mehr Anpassungsfinanzierung
Die Frage der Klimafinanzierung hat die Verhandlungen im Bereich der Klimaanpassung erschwert. Längst ist klar, dass die an der letztjährigen COP29 vereinbarten 300 Milliarden US Dollar jährlich bis 2035 nicht ausreichen. Mit diesem Geld soll der Globale Süden im Klimaschutz und in der Anpassung an die Klimaerwärmung unterstützt werden.
Tatsächlich wird der Finanzierungsbedarf für die Anpassung allein auf jährlich 215 bis 387 Milliarden US-Dollar geschätzt – bis 2030, danach wird er wegen der sich häufenden und intensivierenden Klimakatastrophen, denen gerade diese Länder stark ausgeliefert sind, höher veranschlagt. Im Schlusstext wurde jedoch nun dazu aufgerufen bis 2035 mindestens dreimal mehr Anpassungsfinanzierung bereitzustellen, das sind fünf Jahre mehr für dieselbe Summe als bisher gefordert.
Die Brasilianische Präsidentschaft versuchte Belem als die COP der innovativen Finanz- und Marktlösungen zu positionieren, um die fehlenden ungebundenen öffentlichen Gelder wettzumachen. So wurde ein Tropenwaldfonds aus der Taufe gehoben, durch den Länder für den Erhalt der Wälder entschädigt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Das Modell soll auch private Investoren und mehrere Milliarden mobilisieren. Eine Forderung nach einem Ende der Abholzung fehlt gleichzeitig im Verhandlungstext jedoch und soll in einem weiteren separaten Prozess nachgeholt werden.
Die Konferenz in Belem führt schließlich zur weiteren Operationalisierung des Marktmechanismus zum Handel mit Emissionszertifikaten des Pariser Abkommens, der es Staaten wie der Schweiz erlaubt, ihre Treibhausgasemissionen durch Zahlungen an Länder des Südens für Reduktionsprojekte vor Ort zu kompensieren, statt sie in der Schweiz weiter zu reduzieren.
Vor der eigenen Türe kehren
In den verschiedenen Events rund um die COP30 zeigte sich außerdem, dass die Praxis, Emissionen zu kompensieren, statt sie am richtigen Ort zu verringern, auch innerhalb des Privatsektors weiter Fahrt aufnimmt und vermehrt auch die Landwirtschaft in Kompensationsprojekte eingeschlossen wird.
Gerade multinationale Firmen, auch mit Sitz in der Schweiz, kompensieren ihre Emissionen und die ihrer Partner entlang der Wertschöpfungsketten durch Kohlenstoffspeicherung in Biomasse und Böden. Eine kürzlich von SWISSAID veröffentlicht Studie zu solchen Projekten im Bereich der regenerativen Landwirtschaft in Ländern des Südens zeigt aber, dass diese im Hinblick auf den Klimaschutz zu kurz greifen.
«Eine Tonne CO2, die in die Atmosphäre ausgestoßen wurde, ist nicht dasselbe wie eine Tonne Kohlenstoff in Form von Humus im Boden irgendwo anders. Es fehlt in diesen Projekten eine stringente Überprüfung, die diese Emissionskompensationen glaubhaft abstützen würden. Zudem werden oft entgegen den Behauptungen weder Biodiversität, Bodengesundheit noch soziale Gerechtigkeit berücksichtigt», sagt Tschirren. «Wenn wir im Klimaschutz echte Resultate erreichen wollen, muss jeder dringendst vor der eigenen Türe kehren.»
Zum Zeitpunkt der Publikation dieser Medienmitteilung ist ein Einspruch Kolumbiens nach wie vor hängig. Dies spiegelt die Bilanz der COP30 gut wider: Die Einheit im Kampf gegen den Klimawandel existiert nicht mehr.
Kontaktpersonen:
Sonja Tschirren, Verantwortliche für das Klima-Dossier, SWISSAID.
Tel: +41 79 363 54 36, s.tschirren@swissaid.ch
Thaïs In der Smitten, Medienverantwortliche SWISSAID,
Tel: +41 77 408 27 65, media@swissaid.ch
th.indersmitten@swissaid.ch www.swissaid.ch
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Fazit zu diesem Artikel: « COP30: Ölreiche Länder und Industrienationen auf eigenen Vorteil bedacht »
Swissaid
Eine lebenswerte Zukunft für die nachfolgenden Generationen in den Partnerländern und weltweit: Auf dieses Ziel hin arbeiten wir bei SWISSAID tagtäglich.
Wir, das sind 40 Personen in Bern und Lausanne und rund 150 meist einheimische Frauen und Männer vor Ort. Und ganz viele Partnerorganisationen und Gönnerinnen, auf deren Vertrauen wir seit Jahren bauen.
Wir sind ein Team, das sein Bestes gibt, Herausforderungen sucht, mitredet und hinterfragt, aber auch versteht und respektiert. Kurz: Wir wollen erfolgreich sein und aufrichtig. Erfahren Sie mehr über uns.
Das oberste Gremium von SWISSAID ist der Stiftungsrat. Seit 2019 wird er erstmals von einem Co-Präsidium geführt. Bastienne Joerchel und Fabian Molina sind mit dem Stiftungsratsausschuss für die strategische Leitung der Stiftung verantwortlich.
Hinweis: Der Über-uns-Text stammt aus öffentlichen Quellen oder aus dem Firmenporträt auf HELP.ch.
Quelle: Swissaid, Pressemitteilung
Originalartikel publiziert auf: COP30: Ölreiche Länder und Industrienationen auf eigenen Vorteil bedacht



